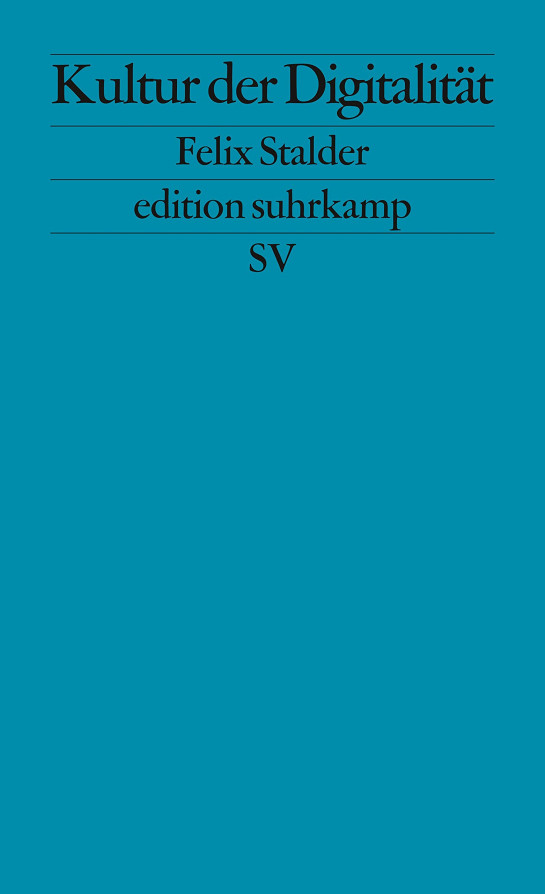Was Digitalität mit uns macht – und wie wir damit umgehen können
So selbstverständlich und omnipräsent digitale Medien und Kommunikationsmittel heute sind, so überraschend ist es, sich bewusst zu machen, dass die heute gängigsten Plattformen allesamt erst nach der Jahrtausendwende gegründet wurden. Die pandemiebedingten Maßnahmen zur Kontaktreduktion haben die digitale Kommunikation noch weiter vorangetrieben: Vor zwei Jahren wusste noch niemand, was Zoom ist. Was macht diese Veränderung mit unserer Gesellschaft? Was bedeutet das für Zusammenhalt und Demokratie? Und wie soll die Politik damit umgehen?
Diese Fragen besprechen Felix Stalder (Züricher Hochschule der Künste) und Veronica Kaup-Hasler (Wiener Stadträtin für Kultur und Wissenschaft) in einem inspirierenden Austausch, der sie von Echokammern über Gemeinschaftsgärten bis zur Zerschlagung von Tech-Unternehmen führt.
Veranstaltungshinweis
Digitaler Humanismus: Menschlichkeit in Zahlen
Montag, 28.03.2022 im Renner Institut
Felix, dein Buch trägt den Titel „Kultur der Digitalität“. Was ist das?
Stalder: Die digitalen Technologien führen zu einem umfassenden medialen Wandel. Ich habe mich daher gefragt: Wie verändert das die Art, wie Menschen die Welt und sich selber wahrnehmen, und wie sie ihre Handlungsmöglichkeiten einschätzen? Das ist eigentlich eine klassische medientheoretische Frage, das hat man auch rund um den Buchdruck untersucht: Welche Welt-Orientierung wird dadurch geschaffen, also welche Vorstellungen davon, wie man in der Welt handeln kann? Weil ein großer medialer Wandel beeinflusst die Beziehungen zwischen Menschen, aber auch zwischen den Menschen und der Umwelt.
Was können wir uns darunter vorstellen?
Stalder: Der Motor, der das antreibt, ist eine enorme Ausweitung der kulturellen Produktion, also Auseinandersetzungen rund um Wertefragen: Was ist richtig? Was ist falsch? Wie sollen wir uns verhalten? Was heißt es heute, eine Familie zu sein? Was heißt es, zu essen? Was ist Geschlechtsidentität? Was ist mein Verhältnis zur Umwelt? Was ist das Verhältnis zwischen Kulturen? Und so weiter. Das sind alles Fragen, bei denen Gesellschaften ständig darum kämpfen, in irgendeiner Weise zu einem Konsens zu kommen. Der Konsens ist immer prekär, und zeitlich und örtlich gebunden, aber es braucht dennoch eine Verständigung darüber: „Ja, wir wollen dieses und nicht jenes.“ Es gibt dann immer Gruppen, die diesen Konsens ablehnen und auf einen anderen Konsens hinarbeiten; das treibt gesellschaftliche Entwicklung an. Was die aktuelle Situation vom Buchdruck unterscheidet ist eben, dass die Mengen sehr viel größer geworden sind. Es gibt einfach jetzt viel mehr, rein quantitativ: mehr verfügbare Informationen, und auch mehr Personen, die sich an diesen Auseinandersetzungen beteiligen.
Kaup-Hasler: Was wir in der Politik merken: Die Nischen sind jetzt wichtiger. Ohne digitale Medien konnte man sich noch viel eher ein klareres Bild über Meinungsströme machen, so wie sie eben in Printmedien, Fernsehen und Radio präsentiert wurden. Jetzt vereinzelt sich das schon in unglaublich viele parallele Diskurse in sozialen Medien und Online-Foren. Das Problem dabei ist: Es gibt kaum Räume, in denen diese parallelen Diskurse zusammenkommen. Weil sie ihre jeweils eigenen Nischen und Plattformen haben, in denen auch Gemeinschaft simuliert wird. Es ist, finde ich, aktuell eine sehr interessante Zeit, Politik zu machen.
Inwiefern?
Kaup-Hasler: In der Coronakrise haben wir neue Formate entwickelt, um – gerade in einer Zeit der Kontaktbeschränkungen – bewusst diese Räume der Begegnung zu schaffen, und zwar in Form von „Townhall-Meetings“. Die Kulturschaffenden hatten sehr große Existenzsorgen aufgrund der Corona-Maßnahmen, und es gab von offizieller Ebene überhaupt keine Begegnung zwischen dem kulturellen Betrieb und den wissenschaftlichen Expert:innen und Statistiker:innen. Diese Begegnung haben wir organisiert: Etwa 30 Leute aus dem Feld der Kultur, vom Sprecher für die Praterunternehmen bis hin zum Staatsoperndirektor, Filmfestivals, Musik – eine repräsentative Auswahl. Die haben wir mit dem Expert:innenstab des Gesundheitsstadtrates in einen Raum im Rathaus versammelt, für 4 Stunden, es war ein sehr konzentrierter Austausch. Das hat einen Raum eröffnet, in dem überhaupt einmal verhandelt werden konnte, und aus dem auch ein gegenseitiges Verständnis entstehen konnte. Dadurch dass wir das relativ schnell gemacht haben, haben wir in Wien eine ganz andere Atmosphäre kreiert – und auch den Hygieneleitfaden der Stadt Wien für Veranstaltungen erstellt.
Stalder: Ich glaube, Städte sind in einer besonders guten Situation, um mit der Aufsplittung gesellschaftlicher Diskurse, die der digitale Raum befördert, umzugehen. Ich stimme nämlich zu, dass der physische Raum die Möglichkeit gibt, ganz andere Formen der Begegnung zu generieren. Das ist eben auch jetzt durch die Corona-Krise klarer geworden: Dass man den Tisch, an dem man die Leute versammelt, ein bisschen größer machen muss, weil es eben nicht mehr reicht, die vier üblichen Expert:innen zu fragen. Und das sehe ich durchaus als demokratiepolitischen Fortschritt. Aber dieses Potenzial gibt es nicht nur im analogen Raum. Von einem kulturellen Blickwinkel würde ich sagen, dass es auch sehr positive Effekte hat, wenn sich Nischen besser artikulieren können. Leute außerhalb des Mainstreams – des Normalen, des Erwarteten – können sich jetzt anders organisieren. Das ist die positive Kehrseite dieser Versplitterung.
Kaup-Hasler: Das stimmt, die können sich in ihren exklusiven Momenten eine kurze Seinsvergewisserung, eine Bestätigung holen. Und sie werden dann auch für die Politik besser sichtbar. Dennoch: Das Problem ist, dass uns durch diese vielen parallelen Echokammern, in denen sich Menschen gegenseitig in ihren Annahmen bestätigen, das Gemeinschaftliche abhandenkommt.
Stalder: Ja, das bisherige Narrativ des Gemeinsamen ist unter dem Druck dieser enormen Komplexifizierung zusammengebrochen. Aber auch hier finde ich: Das muss man zunächst einmal positiv sehen. Weil das macht einen ungeheuren Raum auf. Die Antwort der Rechten ist: „Wir wollen wieder zurück zur alten Welt. Wir wollen, dass die Frauen wieder zurück an den Herd gehen. Wir wollen, dass die Ausländer wieder Ruhe geben. Wir wollen wieder eine Leitkultur.“ Die Aufsplittung der gesellschaftlichen Diskurse in parallele Räume erklärt für mich, warum diese Sehnsucht nach dem Alten so populär ist. Aber eine wirkliche Antwort bieten die rückwärtsgewandten Gesellschaftsbilder ja auch nicht. Es gibt ja Gründe, wieso diese alten Gesellschaftsformen in die Krise gekommen sind. Die Frage ist jetzt also: Wie kann man die enorme Vervielfältigung und Divergenz dieser Standpunkte und Erfahrungen produktiv machen? Das ist der Punkt an dem wir stehen. Und diese Frage öffnet den Raum für institutionelle Experimente, wie eben die „Townhall-Meetings“ von denen Sie gerade erzählt haben.
Kaup-Hasler: Das Format haben wir jetzt wieder angewendet, zur Diskussion über das Dr. Karl Lueger Denkmal. Das Denkmal ist sehr umstritten und wird breit problematisiert, zurecht. Es gibt aber einen sehr breiten Bogen an Meinungen, die in den unterschiedlichen Social Media Foren ausgedrückt werden. Da haben wir 50 Menschen zusammengebracht – von konservativen Historiker:innen bis zu jenen, die das Denkmal am liebsten sofort abtragen wollen. Die haben wir für 3 Stunden in einem Raum miteinander sprechen lassen, mit der Absicht, sie aus ihren Echokammern herauszuholen. Das ist also ein Tool, mit dem ich jetzt arbeite, und wo ich festgestellt habe, dass wir damit unglaublich schnell weiterkommen, immer wieder.
Stalder: Wie Sie sagen, das ist ein Format, das man idealerweise relativ früh macht, wenn es noch eine Bereitschaft zur Diskussion gibt. Weil wenn die Fronten sehr verhärtet sind, dann geht es oft nicht mehr. Rund um Corona, die Maßnahmen und die Impfung, sind wir jetzt teilweise an dem Punkt angekommen, wo es überhaupt keine Diskussionsgrundlage mehr gibt und man diejenigen, die nicht wollen, nicht überzeugen wird. Das ist eigentlich schon ein eklatantes gesellschaftliches und politisches Versagen, dass wir überhaupt an dem Punkt sind, oder? Aber ja, hin und wieder gehen die Dinge schief, und dann muss man sich überlegen: Was macht man an dem Punkt?
Wo seht ihr die Rolle der Sozialdemokratie in der Corona-Krise?
Kaup-Hasler: In Wien zeigt sich sehr deutlich, wie wichtig und richtig sozialdemokratische Politik ist. Es gibt gut ausgebaute öffentliche Daseinsvorsorge, die gut zugänglich ist für alle und gut funktioniert.
Stalder: Mich wundert es nicht, dass die Sozialdemokratie das sehr gut kann. Das ist der Kern ihrer historischen Kompetenz: Gute öffentliche soziale Infrastruktur für alle.
Kaup-Hasler: Wir sehen jetzt auch international überall Formen der Rekommunalisierung, in Berlin etwa, wo die Stadt Leistungsbereiche wieder zurückkauft, die sie schon privatisiert hatte, sie also wieder zu geteilten, gemeinschaftlichen Gütern und Ressourcen macht, die für alle zugänglich sind. Die Bedeutung von sozialer Infrastruktur ist in den letzten beiden Jahren in einer Art und Weise nochmal klar zu Tage getreten. Da wurden linke, progressive Werte im schönsten Sinne wieder aktualisiert und nochmal bewusst gemacht.
Stalder: In den letzten 100, 150 Jahren bewegte sich das Pendel immer zwischen Markt und Staat: Was soll der Markt regeln, und was der Staat? Gegen Ende des letzten Jahrhunderts, mit dem Siegeszug des Neoliberalismus, ist das ganz weit in Richtung Markt ausgeschlagen – und dort auch sehr eindeutig an seine Grenzen gestoßen, mit fatalen Folgen. Das ist natürlich zu benennen und zu kritisieren – wir können aber auch die Frage neu denken: Nicht mehr nur als Verhältnis zwischen Staat und Privat, sondern noch freier.
Du sprichst hier die Idee der Commons an.
Stalder: Ja. Commons sind Prozesse, wo Menschen sich zusammentun um gemeinsam Dinge zu produzieren, zu verteilen, zu verwalten. Dahinter steht ein sehr grundlegendes Verständnis von selbstorganisiertem gemeinschaftlichem Handeln. Das ist ein Bereich, der noch zu entwickeln ist und dafür braucht es eine veränderte gesellschaftliche Infrastruktur, hier kann auch die Technologie helfen. Von der Politik braucht es die entsprechenden Regularien und Rahmenbedingungen, damit dieser Bereich gleichberechtigt neben den anderen Bereichen funktionieren kann.
Kaup-Hasler: Vielleicht müssen wir staatliche Strukturen in Zukunft etwas anders konnotieren und eher als Ermöglicher oder Organisator von Gemeinwohlinteresse verstehen. Aber diesen Reflex, den Staat als das Schreckgespenst zu sehen, gegen den es Widerstand braucht – das wird uns nicht weiterbringen.
Stalder: Es gibt Bereiche, wo es absolut Sinn macht, zu sagen: „Jeder Mensch ist gleich und hat gleiche Voraussetzungen.“ Nämlich im Bereich der Bildung, im Gesundheitswesen, beim Wohnen und so weiter. Diese Bereiche müssen grundsätzlich gegeben sein und zugänglich sein. Dann gibt es Bereiche, wo man sehr gut sagen kann, dass das Konkurrenzmotiv – innerhalb gewisser Regelungen – hilft, bestimmte Probleme zu lösen. Der Markt also. Und dann gibt es aber noch relativ große Bereiche, wo sich die Unterschiedlichkeit in der Gesellschaft selber artikulieren können muss. Das betrifft lokale Initiativen, wie Bildungsgemeinschaften oder Gemeinschaftsgärten, es geht aber auch größer, beispielsweise Food-Coops oder auch im Bereich der Energieversorgung. Für solche Formen der Selbstorganisation von Menschen gibt es jetzt ein stärkeres Bewusstsein, eine Fähigkeit und ein Interesse, Dinge selber zu machen.
Kaup-Hasler: Sprechen wir hier nicht von relativ alten Modellen, die jetzt in einer neuen Sphäre des Öffentlichen, nämlich im digitalen Raum, sich nochmal verästeln, multiplizieren und verstärken? Also Dinge, die früher in Zirkeln, Gruppierungen, Seilschaften organisiert wurden. Die Frage ist dann, wie in diesem digitalen Raum politische Meinungsfindung stattfindet, wie also auch hier Formen der Mitbestimmung möglich sind. Also ich weiß nicht, ob das so neu ist. Die Dimension ist neu.
Stalder: Die Dimension ist neu, aber auch die Zusammensetzung und die Zielrichtung haben sich verändert. Diese ganze Welt der Vereine und Clubs ist einerseits in die Krise gekommen durch Individualisierungsprozesse und Konsumkultur, aber andererseits formiert sie sich auch neu.
Kaup-Hasler: Sie formiert sich auch länderübergreifend, es ist viel globaler geworden, das heißt, die Gleichgesinnten in bestimmten Thematiken kannst du weit über deine lokalen Grenzen hinaus finden. Da können Funken überspringen, wie wir es bei Fridays for Future bemerkt haben. Gleichzeitig sehen wir vor diesem Hintergrund des Globalisierten auch eine Neubelebung analoger Formate. Beispielsweise in Form von lokaler Vernetzung, wie die „Ver-Kiez-isierung“ in Berlin: Einerseits die große Metropole, Künstler:innen aus aller Welt – und daneben die extrem dörfliche Wiederbelebungen von Ritualen und auch kleinbürgerlichen Verhaltensweisen.
Stalder: Ich sehe darin eine Sehnsucht nach etwas Überschaubarem. Eine der interessantesten städtischen Bewegungen sind Baugruppen, also Gruppen von Menschen, die selbstorganisiert ihr Wohnhaus gestalten, Gemeinschaftsflächen verwalten, gemeinschaftliche Aktivitäten organisieren. Das ist natürlich eine Mittelklasse-Bewegung, aber die experimentieren mit Neuverhandlungen darüber: Welche Funktionen sehen wir im privaten Wohnraum, und welche im Gemeinschaftlichen? Was brauchen wir, um Gruppen dieser Größe zu organisieren? Und das schlägt sich auch physisch nieder, in gebauten Strukturen. Und ich denke, dass aus diesen Erfahrungen auch Lehren gezogen werden können, die nicht nur rein schichtspezifisch sind, sondern die ganz grundsätzlich Formen des Zusammenlebens betreffen.
Ist das nicht prinzipiell ein Problem mit Commons, mit diesen lokalen selbstorganisierten Projekten? Dass genau jene, die es gewohnt sind, dass ihre Stimme gehört wird, auch diejenigen sind, die Commons in Anspruch nehmen und dominieren?
Stalder: Ich würde sagen das ist ein kulturelles Problem: Wer hat überhaupt die Kapazität, sich zu organisieren? Da hilft natürlich kulturelles Kapital, aber es hilft auch so etwas wie eine historische Erinnerung. Also es ist kein Wunder, dass die Commons-Bewegung beispielsweise in Spanien viel stärker ist, weil da gibt es die historische Erinnerung des Widerstands gegen die Diktatur Francos. Solche kollektiven Erinnerungen fehlen an vielen anderen Orten. Aber es gibt das auch in gewissen Einwander-Kulturen, die keineswegs privilegiert sind. Wenn man etwa sieht, wie sich die kurdische Gemeinschaft organisiert, das ist beeindruckend – und das ist kein Mittelschichtphänomen. Natürlich hilft es, wenn man Zeit und Geld hat, aber ich würde es nicht darauf reduzieren. Große Teile der Mittelschicht können da überhaupt nicht mit, die sind im konservativen Vorstadt-Utopie-Modus gefangen, wo sehr wenig passiert.
In deinem Buch beschreibst du zwei Richtungen, in die sich Demokratie in der Kultur der Digitalität entwickeln kann.
Stalder: Ja. Die eine Möglichkeit ist eine technokratisch-autoritäre: „Wir können uns nicht mehr einigen, deshalb delegieren wir unsere Entscheidungen an den Algorithmus.“ Die andere Möglichkeit ist, zu sagen, wir entwickeln neue Formen, die diese Diversität artikulieren können. Dafür sind Commons eine geeignete Form, um sich in dieser Komplexität zurecht zu finden, und dabei kann Technologie sehr hilfreich sein. Die Formen, die uns momentan vom Markt angeboten werden – Plattformen, Social Media – funktionieren alle technologisch-autoritär.
Kaup-Hasler: Dabei war ja gerade die Entwicklung des Internets und der sozialen Medien begleitet von einem ganz großen Demokratie- und Freiheitsversprechen, das sich allerdings so nicht eingelöst hat.
Stalder: Die Unternehmen machen wahnsinnig viel Geld damit und müssen sich um die Kollateralschäden – also die Zerstörung einer demokratischen Diskussionskultur – nicht scheren. Die Idee, dass es eine zentrale Kommunikationsplattform gibt, die sämtliche Kommunikation in der Welt organisieren soll, ist ja eine Horrorvorstellung. Aber etwas Ähnliches haben wir jetzt. Und man weiß nicht genau, welche Form der Regulierung man jetzt anwenden soll: Handelt es sich hier um ein öffentliches Medium im klassischen Sinn, oder ist es Privatkommunikation, die man ja eigentlich nicht regulieren will? Vor dem Hintergrund dieser Ratlosigkeit ist dieser fast rechtsfreie Raum entstanden.
Wie soll der Staat, die Politik nun damit umgehen?
Kaup-Hasler: Wir müssen als Öffentlichkeit mit der Realität umgehen, dass die Profiteure dieser Entwicklung im Silicon Valley kein Interesse daran haben, hier groß Demokratisierungsprozesse in die Wege zu leiten. Das müssen also wir tun, die öffentliche Hand, auf kommunaler, auf nationaler und vor allem auf Europäischer Ebene. Der Begriff des „Digitalen Humanismus“ kann uns hier sehr weiterhelfen. Die Wissenschaft hat hier einen wichtigen Bezugspunkt geschaffen mit dem „Wiener Manifest für Digitalen Humanismus“, und um das weiterzuentwickeln braucht es Forschung und öffentliche Gelder. In unserer Kooperation mit den Wiener Universitäten und Fachhochschulen stellt der Digitale Humanismus einen Schwerpunkt dar. Über den WWTF, den Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds, stellen wir mehrere Millionen Euro für Forschung zu diesem Thema zur Verfügung. Wir vergeben als Stadt Wien den Hedy Lamarr Preis an Forscherinnen im Bereich der Informationstechnologie – auch ganz gezielt um Frauen in diesem Bereich zu stärken.
Stalder: Die digitalen Kommunikationsplattformen sind im Grunde nicht reformierbar, sondern müssen einfach deutlich reduziert werden. Das kann geschehen durch die Zerschlagung von Unternehmen, die Entkoppelung von Diensten und so weiter. Die Plattformen sagen: „Wir können die Kommunikation hier nicht regulieren, wie sollen wir in 200 verschiedenen Sprachen Content-Moderierung machen?“ Da kann man nur sagen: „Hey, das Problem habt ihr euch selber gemacht, es ist ja nicht unser Fehler, dass ihr euer eigenes Business nicht könnt.“ Da müssen die öffentlichen Institutionen, vor allem auf EU-Ebene, sehr viel stärker und selbstbewusster auftreten. Und ein weiterer wichtiger Punkt: Die öffentliche Hand reguliert ja nicht nur, sondern sie ist selbst ein riesiger Marktteilnehmer. Da kann man sich fragen: Warum investiert die Öffentlichkeit so viel Geld in Technologien, die man eigentlich nicht will? Da wäre es doch eindeutig besser, diese Ressourcen in den Aufbau eines eigenen technologischen Ökosystems zu stecken.
Zu den Personen
Felix Stalder ist Professor für Digitale Kultur und Theorien der Vernetzung an der Zürcher Hochschule der Künste, Vorstandsmitglied des World Information Institute in Wien und Mitglied der Technopolitics Working Group in Wien. Er ist auch Teil des Netzwerk Wissenschaft im Karl-Renner-Institut. Seine umfangreichen Publikationen finden sich auf http://felix.openflows.com/.
Veronica Kaup-Hasler ist Stadträtin für Kultur und Wissenschaft in Wien. Davor war sie Intendantin des Kunstfestivals steirischer herbst, Leiterin des deutschen Festival Theaterformen, sowie Dramaturgin bei den Wiener Festwochen, sowie Lehrbeauftragte an der Wiener Akademie der Bildenden Künste.
Leseempfehlung
„Kultur der Digitalität“, von Felix Stalder (edition suhrkamp, 2016)